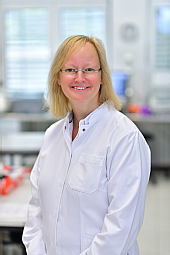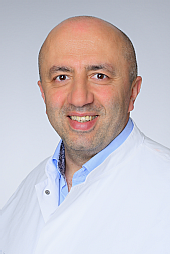Sie sind hier:
- Startseite
- Diagnostik
- Nationales Referenzzentrum für Papillom- und Polyomaviren
Nationales Referenzzentrum für Papillom- und Polyomaviren
Leistungsangebot
- Beratung von Fachpersonal zu Fragen der Diagnostik, der Prophylaxe und der Therapie von Humanen Papillomvirus (HPV)- und Polyomavirus (HPyV)-assoziierten Erkrankungen. Anfragen von Privatpersonen oder Patienten/Patientinnen können wir aus Kapazitätsgründen leider nicht beantworten. Bitte wenden Sie sich an Ihre behandelnden Ärzte/innen. Informationen zu HPV und zur Diagnostik, Prävention und Therapie von HPV-bedingten Erkrankungen finden Sie in deutscher Sprache unter den unten genannten Links.
- Beratung von Laboratorien bei der Diagnostik von Papillom- und Polyomavirus-Infektionen
- Typisierungen von HPV in diagnostischen Sonderfällen nach vorheriger Absprache
- Isolierung und Sequenzierung neuer HPV-Typen sowie Abgabe der Plasmide auf Anfrage
- Nachweis von BKPyV, JCPyV, MCPyV und weiterer Humaner Polyomaviren in diagnostischen Sonderfällen nach vorheriger Absprache
- Führen einer Sammlung diagnostischer Referenzmaterialien für HPV und humane Polyomaviren sowie Abgabe auf Anfrage
- Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Ärztinnen und Ärzte sowie Mitarbeiter/innen des öffentlichen Gesundheitsdienstes
- Evaluation von kommerziellen, diagnostischen Testsystemen für HPV und HPyV
- Unterstützung von nationalen und internationalen Ringversuchen zu HPV und HPyV
- Durchführung von epidemiologischen Studien, z.B. zur Aufklärung des Zusammenhangs von Erregernachweis und Erkrankung oder im Rahmen von Vakzinierungsstrategien
Hinweise zum Materialversand
Geeignete Materialien für die HPV- und HPyV-DNA-Diagnostik sind Abstriche und Biopsien, für BKPyV Urin- und EDTA-Blut, und für JCPyV Liquor und EDTA-Blut. Auch aus Paraffin-eingebettetem Gewebe kann virale DNA extrahiert werden. Abstriche für den DNA-Nachweis werden idealerweise in Transportmedium für die Zytologie (z.B. PreservCyt) versandt. Der Transport von Abstrichen und nativen Biopsien kann – sofern nur DNA nachgewiesen werden soll - bei Raumtemperatur erfolgen. Biopsien können auch gekühlt (+4°C) oder auf Eis versendet werden.
Für die Anforderung von Einsendungen für das Nationale Referenzzentrum benutzen Sie bitte folgenden Einsendeschein:
Weiterführende Informationen zu HPV
- RKI-Ratgeber Humane Papillomviren
- HPV-Impfung - Übersichtsartikel
- S3-Leitlinie Impfprävention HPV-assoziierter Neoplasien
- HPV-Impfung von Jungen
- Informationen zu HPV-assoziierte Läsionen der äußeren Genitalregion und des Anus (S2k-Leitlinie)
- Informationen zur Prävention des Zervixkarzinoms (S3-Leitlinie)
- S3-Leitlinie Analkarzinom: Diagnostik, Therapie und Nachsorge von Analkanal- und Analrandkarzinomen